Kolumbien, das bedeutet für uns vor allem: Ein neuer Kontinent! Wir sind nun durch Nord- und Mittelamerika nach Südamerika gereist. Und auf dem neuen Kontinent wollen wir so lange in den Süden fahren bis die Straße endet. Bis nach Feuerland. Doch das ist noch ein langer Weg.
Ebenso ist es ein langer Weg, bis wir wieder in unserem Pajero sitzen und gen Süden fahren können. Zwar sind es nur 500 Kilometer Luftlinie von Panama-Stadt bis nach Cartagena und ein Container-Schiff braucht dafür auch nur etwas mehr als einen Tag. Aber der Prozess, der sich anschließt um das Auto wieder aus dem Hafen zu bekommen ist kompliziert und langatmig. Dazu verzögern sich die Abfahrtszeiten der Schiffe gern mal um ein paar Tage. Geduld ist also angesagt. Und wo kann man sich besser in Geduld üben, als auf einer schönen Insel? Deswegen sind wir gleich nach unserer Ankunft in Kolumbien auf ein Boot gesprungen und für 2 Tage auf eine kleine Insel gefahren. Abschalten und Energie tanken.



Zurück auf dem Festland machen wir es uns in der hübschen Kolonialstadt Cartagena gemütlich. Wir haben ein kleines Apartment mit Balkon im Szeneviertel Getsemani. Wir schlendern durch die Straßen, gehen lecker Essen, lernen bei einem Kochkurs über die hiesige Kulinarik, nehmen zwei Abende lang Privatstunden im Salsa-Tanzen und probieren unsere neu erlernten Fähigkeiten eifrig aus. Phia entdeckt ein nahegelegenes urig-deutsches Restaurant mit ausgezeichneter Küche. Unser kulinarisches Fernweh kommt dort voll zum Ausdruck und schnell werden wir Stammgäste bei Stefan, einem deutschen Auswanderer und seinen leckeren Rouladen mit Spätzle. Außerdem gibt es etliche gute Bars in Cartagena, in denen man prima Craft Beer verkosten kann. Zu all dem Vergnügen kommt aber das lästige Prozedere unseren Pajero wieder aus dem Hafen zu bekommen. Unser Schiff hat „nur“ 2 Tage Verspätung. Kaum ist der Container vom Schiff, muss es sehr schnell gehen. Eilig werde ich per Whatsapp zum Hafen zitiert, wo ich Dainan aus Kanada und Roy aus Holland treffe, die ihr Motorrad bzw. ihren Jeep auch bei uns im Container haben. Zunächst geht alles sehr schnell und eine Stunde später erblicken unsere Fahrzeuge wieder das Tageslicht. Doch die Räder drehen sich nur kurz. Bis alle Zollformalitäten geklärt sind muss das Auto im Hafen verbleiben. Unverschlossen. Und mit Schlüssel im Zündschloss. Das gefällt uns gar nicht! Dazu ist es Donnerstag. Und die Dame vom Zoll ist nicht die schnellste. Die treffen wir einen Tag später im Zollbüro, als sie die Fehler ausbessert, die sich in unsere Zolldokumente geschlichen haben. Die müssen dann per Mail in die Hauptstadt Bogota geschickt und dort unterschrieben werden. Vor dem Wochenende wird das nichts mehr. Und so müssen wir bis Montag warten, bis die Zolldokumente komplett und die Fahrzeugversicherung ausgestellt werden kann. Das nervt. Wie gerne hätten wir den Pajero Freitag schon wieder gehabt. Da war nämlich Phias Geburtstag und das wäre doch ein tolles Geschenk gewesen. Aber wir machen das Beste draus, haben einen schönen Abend mit unseren „Container-Buddys“ (Phia bekommt sogar von unserem Kanadier eine große Geburtstagstorte mit Kerzen und Ständchen) und gehen dann abends Salsa tanzen. Cartagena ist beim besten Willen keine schlechte Option um auf das Auto zu warten.


















Als wir den Pajero dann endlich in die Freiheit entlassen dürfen ist es schon später Montagnachmittag. Heute noch weiter zu fahren macht keinen Sinn. Lieber nochmal in die deutsche Kneipe und sich bei Paulaner und Roulade gebührend von Cartagena verabschieden. Das war doch schon mal ein toller Kolumbien-Auftakt. Aber es sollte noch besser werden und wir würden uns erneut in ein Land verlieben, dass wir vorher noch nicht gekannt haben.




Es dauert eine Weile bis wir die letzten Ausläufer Cartagenas hinter uns lassen und tiefer ins Inland eintauchen. Die erste Station ist Mompox. Eine kleine Kolonialstadt in einem gigantischen Fluss- und Schwemmlandgebiet. Aus Cartagena hat Phia eine Erkältung mitgebracht (von den auf 15 Grad eingestellten Klimaanlagen) und so können wir den ersten Abschnitt unserer Südamerika-Tour nur bedingt genießen. Doch wieder machen wir das Beste draus, buchen uns spontan, kurz nach unserer Ankunft in Mompox eine Sonnenuntergangstour auf einem Ausflugsdampfer und kämpfen tapfer gegen die Moskitos, die uns trotz der lauten Musik auf dem Dampfer gehörig zerstechen.








Die nächste Station heißt Playa Belen. Mit einem Strand hat das aber gar nichts zu tun, denn die Kleinstadt liegt in den Ausläufern der kolumbianischen Anden. Wir campieren am Rande der Siedlung im Nationalpark Estoraques, dem kleinsten Nationalpark Kolumbiens. Doch der braucht sich nicht zu verstecken, denn die verrückten Felsformationen begeistern jeden, der sie zu Gesicht bekommt. Vieles erinnert uns an die großen Nationalparks in den USA. Einfach Wahnsinn diese Natur! Das macht Hunger auf mehr. Überhaupt haben wir mächtig Hunger und machen uns eilig ans Kochen. Lasagne soll es heut geben. Aber erstmal ist das Benzin vom Kocher alle. Alles kein Problem, haben wir doch einen kleinen Kanister auf dem Dach, von dem wir die letzten Tropfen Benzin in den Kochertank schütten. Doch angehen will der Kocher nicht mehr. Diagnose nach 1 h: Reichlich Kondenswasser hatte sich im Kanister gebildet und am Ende waren im Kocher 1/3 Wasser und 2/3 Benzin. Da springt kein Benzin-Kocher mehr an. Glücklicherweise fange ich den Ranger von Nationalpark ab, als er gerade Feierabend machen möchte und er nimmt mich mit seinem Motorrad mit zur nächsten Tankstelle. Der Weg dahin war durch die einsetzenden Regenfälle unterspült und matschig. Der Ranger hatte aber einige wichtige Telefonate zu führen. Einhändig schlitterten wir so zur Tankstelle. Jeder deutsche Motorradfahrer wäre mindestens dreimal gestürzt. Aber die Kolumbianer haben das einhändig-telefonierend-mit-dem-Moped-durch-den-Schlamm-fahren einfach im Blut. Bis wir dann allerdings unsere Lasagne endlich essen konnten gingen nochmal drei Stunden ins Land.










In Städten campen wir eigentlich nie, schon gar nicht wild. Da nehmen wir uns eher ein Hotel, denn wir haben ja keine Toilette an Board. Abends auf der Straße neben das Auto pullern ist nicht so schön. Doch bei unserem nächsten Stellplatz sollten wir eine Ausnahme machen. Mitten auf dem gepflasterten Marktplatz von Gramalote schlagen wir unser Camp auf, öffnen die Markise und das Hochdach. Einwohner gibt es hier nicht mehr. Denn Gramalote ist eine Geisterstadt. Im Dezember 2010 drohte der Berghang, auf dem sich das 3000-Seelen-Dorf Gramalote befindet komplett abzurutschen und das gesamte Dorf zu begraben. Das Dorf wurde also über Nacht evakuiert und schnell entschieden: Hier wird keiner mehr zurückkommen. Innerhalb kürzester Zeit mussten die Einheimischen ihre Habseligkeiten aus den Häusern holen. Ein neues Dorf wurde nur wenige Kilometer entfernt errichtet: Neu-Gramalote. Die Kirche des alten Dorfes war da schon durch einen Erdrutsch eingestürzt, nur einer der beiden Kirchtürme ist noch stehen geblieben und steht noch heute als einziges Gebäude in der Stadt. Die anderen Häuser sind entweder eigestürzt oder wurden von den Besitzern zurückgebaut, um aus den Ziegeln noch etwas Geld zu machen. Der Marktplatz auf dem wir stehen weist tiefe Risse auf. Definitiv einer der verrücktesten Stellplätze auf unserer Reise.



Weiter führt uns unsere Route nach Pamplona. Wir sind nun ganz nah an der venezolanischen Grenze und das merkt man auch an den Spritpreisen. Wir tanken für stolze 37 Cent den Liter Diesel. Daran könnte man sich gewöhnen. Da wir in Pamplona keinen schönen Stellplatz finden, checken wir in einem Hotel ein. Bei Hotelübernachtungen ist es für uns immer wichtig, dass wir auch einen sicheren Parkplatz für unseren Pajero haben. Die Vorrausetzung wird auch in Pamplona erfüllt, scheitert jedoch fast an der Höhe der Zufahrt. Hier muss der Hotelangestellte erst mit einem Maßband kommen, bevor wir durchfahren. Und in der Tat: es sind nur ein/zwei Zentimeter Luft. Wie es der Zufall so will stolpern wir abends in ein Oktoberfest. Das ist uns schon in Cartagena in der deutschen Kneipe passiert. Nur hier ist es nicht wirklich ein deutsches Volksfest, sondern ein kleines Festival für verschiedene Craftbiere aus kleinen Brauereien der Region. Klar, dass da Phia gleich hellauf begeistert ist und mich wie immer mit der Begeisterung ansteckt. Wir haben tolle Gespräche mit den Brauern, probieren leckeres Bier aus der Region und werden sogar vom Moderator der Veranstaltung als weit gereiste Brauer aus Deutschland angekündigt, woraufhin wir tosenden Applaus der Besucher ernten. Was für ein Abend!


„Vertrau nicht auf Google Maps!“ sage ich zu Phia, die kreidebleich auf dem Beifahrersitz hockt. Wir haben aber auf Google Maps vertraut und sind nicht der Beschilderung der Hauptstraße gefolgt, um Pamplona zu verlassen. Die Nebenstraße hatte stolze 25 % Steigung und war so breit wie der Pajero. Phia hat sich richtig nach vorne gebeugt, weil sie Angst hatte, dass wir sonst nach hinten umkippen. Ich musste sogar zwischendurch Untersetzung einlegen, sonst wären wir nicht hochgekommen. Offroadgang in der Innenstadt. Nur möglich in Kolumbien. Die Bergstraße führt uns über einen 3500 Meter hohen Bergpass, was der Pajero ohne Probleme schafft. Dann weichen wir aber doch von der vorgeschlagenen Route ab und nehmen für 2 Stunden eine unbefestigte Nebenstraße. Wir umfahren so nicht nur eine Großstadt, wir sehen auch tolle Landschaften, haben null Verkehrsaufkommen und mächtig Spaß beim durchgeschüttelt werden. Eine Abkürzung ist es zwar nur von den Kilometern her, die Straße hat sich aber mächtig gelohnt.



Am Ende des Tages schlagen wir unser Camp am beeindruckenden Chicamocha-Canyon auf. Wir können uns gar nicht satt sehen an den Bergpanoramen und bleiben gleich einen Tag länger, um das alles zu verdauen und Pläne für die Weiterfahrt zu schmieden.


Da es zuvor so gut funktioniert hat, wählen wir für die Fahrt zu dem 2 Stunden entfernten Barichara wieder eine kleine Nebenstraße, anstatt des belebten Highways. Zuerst werden wir in unserer Entscheidung bestätigt, doch dann sind wir uns nicht mehr so richtig sicher. Denn die Straße verwandelt sich in eine Matschpiste und wir schleudern von rechts nach links immer bemüht dem Graben auszuweichen. Doch mit fahrerischem Geschick schaffen wir es und kommen matschüberströmt in Barichara an. So muss ein Geländewagen eben auch aussehen.


In Barrichara bleiben wir vier Nächte hängen. Das liegt nicht nur an dem tollen Campingplatz, der von einem holländischen Paar geführt wird und mit frisch gebackenem Brot und selbstgemachter Marmelade lockt. Hier lernen wir auch andere Overlander kennen und haben tolle Gespräche. Wir legen kleine Wanderungen in der Umgebung ein, besuchen eine der schönsten Kleinstädte Kolumbiens und schmieden weiter Pläne. Die verändern sich etwas, da sich Phias Erkältung nun auf mich übertragen hat. Eigentlich wollten wir tiefer in die Berge fahren, um bis auf 4600 Meter hoch zu wandern. Doch ist das so eine gute Idee mit einer Erkältung? Wie gut, dass wir auf dem Campingplatz etwas zur Ruhe kommen und somit auch Kraft für die Weiterreise sammeln können.



Nachdem wir uns zwei Möglichkeiten für die Weiterreise herausgearbeitet haben, entscheiden wir uns kurz vor der Abfahrt für eine dritte und steuern doch die Berge an. Zwei Tage brauchen wir dafür zur Anreise. Der Beginn wird überschatten von einem Unfall, dessen Zeugen wir werden. Kurz nach Barichara fährt ein Motorrad aus einem Hof. Der Fahrer wirkt etwas verwirrt und fährt lange Zeit starke Zickzacklinien vor uns. Den Helm natürlich lässig am Fuß, statt auf dem Kopf. Will der sich nur einfahren? Oder ist der besoffen? Letzteres ist wohl der Fall, denn der Fahrer lenkt sein Kraftrad nach wenigen Kilometern direkt in den Graben, wird dadurch nach oben katapultiert und stürzt wieder zurück auf die Straße. Wir halten sofort an und sichern die Unfallstelle, denn das Ganze ist ca. 30 m vor uns passiert. Schnell eilen weitere Helfer herbei. Es sieht nicht gut aus um den Motorradfahrer. Aus seinem Ohr und einer großen Platzwunde am Kopf rinnt Blut und er röchelt benommen. Als der Krankenwagen eintrifft ist es für uns Zeit weiter zu fahren. Doch die Bilder lassen uns lange Zeit nicht mehr los. Es zeigt mal wieder wie viel Glück auch dazugehört so eine Reise heil zu überstehen. Sind wir doch schon über 30 000 km gefahren und haben dennoch erst ca. die Hälfte unserer Strecke geschafft. Wir hoffen das Beste, dass wir weiterhin gut durchkommen und von Unfällen verschont bleiben.
Der Weg nach El Cocuy lenkt uns etwas ab. Abenteuerlich schlängelt sich die Straße immer weiter nach oben. Für Stunden sind wir das einzige Fahrzeug auf dem Weg. Wir legen einen Zwischenstopp auf einer Hochebene auf 3200 Meter ein und genießen die Ruhe und die Abgeschiedenheit. Leider zwingt uns abendlicher Regen vorzeitig ins Bett, sonst hätten wir es noch länger am Lagefeuer ausgehalten. Die Weiterfahrt verzögert sich fast, denn der Pajero hat mächtig Probleme zu starten. Nur mit Mühe und Not kommt der Motor in Schwung. Da wissen wir noch nicht, dass wir bald vor ernsthafteren Startschwierigkeiten stehen werden.




Im Dorf Cocuy lassen wir uns zwei Nächte nieder und starten drei Akklimatisierungswanderungen. Bei der letzten geht es schon auf 4.000 Meter hinauf. Dabei muss gesagt sein, dass wir schon bis auf 4.000 Meter hochfahren und der Weg noch einige sanfte An- und Abstiege für uns bereithält. Aber für eine Akklimatisierung ist das perfekt. Der Pajero hat wieder seine Startschwierigkeiten, aber noch ist alles gut. Nach der letzten Akklimatisierungswanderung warten wir auf unsere holländischen Freunde Rob und Dieke, die uns für die große 20 km Wanderung auf 4600 Meter begleiten wollen. Dazu legen wir eine kleine Rast am Wegesrand ein und warten bis die Wolken langsam das Gebirgspanorama freigeben. Ein Einheimischer spricht uns an und zeigt uns einen Aussichtspunkt, von dem wir noch eine viel bessere Aussicht auf die Berge haben. Und von da aus sehen wir auch den VW-Bus der Holländer, der sich die Berge hochquält. Die Freude über das Wiedersehen ist groß! Morgen geht’s dann noch weiter in die Berge.





Wir schlagen unser Camp an einem Bauernhaus auf und besprechen die Wanderung. Damit wir überhaupt im Nationalpark El Cocuy wandern dürfen, mussten wir eine Nationalparkgebühr (20 Euro p.P) bezahlen und eine obligatorische Versicherung (7 Euro p.P.) abschließen. Außerdem mussten wir eine Art Belehrungs-Präsentation der Ranger (ca. 1h, Online) anschauen und schließlich einen Guide anheuern. Ziemlich viel Aufwand, um in den Bergen zu wandern. Doch vor einigen Jahren sind die Ureinwohner auf die Barrikaden gegangen. Der Grund: Für sie ist Schnee heilig und darf nicht berührt werden. Daran haben sich die Besucher des Nationalparks freilich nicht gehalten, woraufhin sich die Ureinwohner in ihrer Tradition und Ehre verletzt gefühlt haben. Damit heute überhaupt Besucher bis zum Fuße der Gletscher wandern können, wurden die Hürden entsprechend hoch gesetzt.


Wir können endlich los und kämpfen uns auf der ca. 20 Kilometer langen Wanderung bis auf 4.600 Meter hoch. 6 Uhr ist Start. Mit dem Wetter haben wir nur bedingt Glück, denn dicke Wolken hängen über den Bergen, die sich auf dem Rückweg reichlich entleeren und uns mächtig durchnässen bei der Kälte. Das ist auch zu viel für den Pajero. Er springt nach der Wanderung nicht mehr an, auch nicht mit Starthilfe und so müssen wir mit Rob und Dieke zur nächsten Unterkunft fahren. Dort gibt es weder heißes Wasser noch ein warmes Kaminzimmer, sodass wir durchgefroren ins Bett purzeln. Ob wir den Pajero wieder zum Laufen bekommen und was am Ende der Grund für die Startschwierigkeiten war, das erfahrt ihr im nächsten Beitrag.















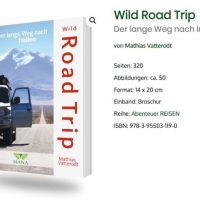
Schreibe den ersten Kommentar